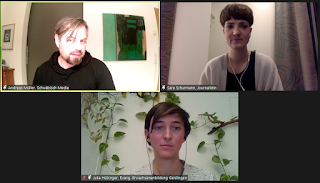Wenn ich das lese, dann kommt mir doch so Einiges ganz schön bekannt vor!
Was folgt daraus für uns? Sich nicht entmutigen lassen, weiter machen! Wir müssen dicke Bretter bohren, werden manchmal verlieren, aber unser Engagement lohnt sich am Ende dann doch!
Denn wie würde unsere Welt ohne dieses Engagement aussehen - ich mag es mir gar nicht vorstellen!
Süddeutsche Zeitung hier
Deshalb hat Zeiner eine Bürgerinitiative gegründet: "Waiblingen klimaneutral"
Sabine Zeiner macht mehr als nur Flyer verteilen. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern hat sie im Sommer über 1000 Unterschriften für einen Einwohnerantrag gesammelt. Der Waiblinger Stadtrat musste deshalb im Oktober darüber abstimmen, ob die Kommune bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Idee für die Initiative hatte Zeiner aus der Zeitung. Dort las sie vom erfolgreichen Einwohnerantrag des Klimabündnisses in der Nachbargemeinde Schorndorf - und beschloss kurzerhand die Gründung eines solchen Projekts für Waiblingen.
Rund 40 Waiblinger und Waiblingerinnen sind mittlerweile dabei. Was für Menschen sind das? "Eine Initiative vereint unterschiedliche Leute aus allen Altersgruppen, Berufsgruppen, politischen Meinungen und Geschlechtern", sagt Zeiner. So engagieren sich in Waiblingen Studierende und Rentner, Zivildienstleistende und Firmenchefs. "Auf ein Ziel geeint kann man dann auch sehr glaubwürdig eine breite Bevölkerungsschicht vertreten." Klimaschutz sei nicht nur etwas für junge Menschen. Eine alte Frau habe sie einmal gefragt, ob es denn nicht auch schneller ginge als 2035. "Schön wär's! Das ist jetzt schon eine extrem anspruchsvolle Zielsetzung", gesteht Zeiner mit leicht erröteten Backen.
Auch Streuobstwiesen können zur Klimaneutralität beitragen
..Die frühzeitig pensionierte Diplomingenieurin besitzt einige Streuobstbäume, die sie selbst bewirtschaftet. Für sie sind auch Äpfel ein Symbol für Klimaneutralität: "Es ist absurd, wie viel Zeug aus dem Ausland hergekarrt wird. Statt Apfelsaft aus China könnte die Stadt die Streuobstwiesen fördern."
Halt im Teilort Beinstein. Hier zeigt Zeiner, dass in Waiblingen schon einiges gut läuft. Ein Wohnviertel wurde auf das ehemalige Firmengelände der Mineralbrunnen AG gebaut. Die öde Brachfläche wurde zu Wohnraum. Zeiner zeigt auf die mit Solarzellen bepflasterten Dächer. Bereits 2006 führte die Stadt die Solaranlagenpflicht für Neubauten ein - als erste Gemeinde in Deutschland. Klimaneutrales Bauen und Sanieren ist ein wichtiger Punkt für die Mitglieder der Initiative.
Denn nach der erfolgreichen Unterschriftensammlung haben die Mitglieder nur ein erstes Ziel erreicht. Nun, nachdem der Antrag der Initiative befürwortet wurde, steht die Stadt vor der Aufgabe, die Klimaneutralität auch zu erreichen. "Waiblingen klimaneutral" hat dafür zehn Themenfelder erarbeitet, zehn Stellschrauben für die nächsten Jahre. "Wir wollen der Stadt nicht vorschreiben, wie sie das zu machen hat. Das wäre arrogant", sagt Zeiner. Die Maßnahmen in ihrem "Klimastadtplan" sollen Vorschläge sein. Mit dabei: Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien, ressourcenschonendes Wirtschaften, mehr öffentliche Verkehrsmittel und CO2-sparendes Bauen.
Der Vorteil einer Bürgerinitiative: Überparteilichkeit
Warum aber wählt man für ein solches Ziel überhaupt die Form der Bürgerinitiative? Politikwissenschaftler Gross sieht einen Vorteil in der Überparteilichkeit solcher Bündnisse. Lokale Probleme könnten dabei losgelöst von Parteiansichten betrachtet werden. Auch bei "Waiblingen klimaneutral" sind Mitglieder unterschiedlichster Parteien vertreten. "Der Klimawandel", betont Sabine Zeiner, "beschäftigt fast alle Parteien." Außerdem, sagt Gross, macht eine Initiative Interessen sichtbar, die im politischen Prozess eher untergehen. "Man bekommt mehr Aufmerksamkeit als mit einem Leserbrief oder einer direkten Beschwerde an Stadtratsabgeordnete." Zudem seien die Hierarchien flacher als in Parteien, was die Mitarbeit erleichtere.
Vor Jahren protestierten die Waiblinger gegen ein Einkaufszentrum - ohne Erfolg
......Die Waiblinger scheiterten, der Wille zu mehr demokratischer Teilhabe aber blieb. "Es war wie eine Geburtsstunde der Bürgerbeteiligung in unserer Stadt, das hat Wellen in die Region geschlagen", sagt Zilian, "viele Bürger anderer Gemeinden forderten mehr Mitsprache." ......
Gelingt "Waiblingen klimaneutral", könnte sich am Alten Postplatz allerdings wieder viel verändern. Auf den bis zu sieben parallel verlaufenden Fahr- und Abbiegespuren sollte es laut Sabine Zeiner bald mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger geben. Denn die Initiative fordert auch eine sozialverträgliche und ökologische Stadtplanung. Waiblingen soll eine Stadt der kurzen Wege werden. Mehr Flächen zur Erholung, weniger Versiegelung, weniger Platz, der für geparkte Autos verloren geht. Mit einem besser ausgebauten ÖPNV-Netz wären Autos - auch das von Zeiner - und Parkplätze in der Innenstadt bestenfalls überflüssig.
Protest zieht mehr Menschen an
Das gefällt natürlich nicht allen Waiblingern. Zwar berichten Zeiner und ihre Mitstreiter bisher von wenig Gegenwind, doch das kann sich schnell ändern: "Vermutlich gibt es dann Protest, wenn die ersten konkreten Maßnahmen auf den Tisch kommen." Klar, Klimaneutralität finden viele gut - Windkraft- und Biogasanlagen in der Nachbarschaft aber schon nicht mehr so viele. Das könnte neue Bündnisse auf den Plan rufen, "Verhinderungsinitiativen", wie Martin Gross sie nennt. Initiativen, die gegen bestimmte Vorhaben sind, bekommen laut Gross deutlich mehr Aufmerksamkeit als solche, die sich nicht gegen, sondern für ein bestimmtes Ziel einsetzen. Ein prominentes Beispiel dafür sind die Proteste gegen Stuttgart 21, den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Die Verhinderung von S21 gelang 2011 zwar nicht, doch es habe die Bürger in ihrem Engagement wachgerüttelt, sagt Zeiner. In der Region und weit darüber hinaus.
Das will auch die Waiblinger Initiative schaffen. In den sozialen Medien machen die Mitglieder auf sich aufmerksam, vernetzen sich mit anderen Initiativen. Aus vielen lokalen Bewegungen wird eine große, die eine übergeordnete Idee verfolgt. Darin, erklärt Gross, liege ein großer Unterschied zu den Bürgerbewegungen der 1970er- und 80er-Jahre. "Dass sich die Initiativen so extrem untereinander und mit Experten austauschen, das gab es früher nicht so."
Das Ziel und der mit Experten entwickelte "Klimastadtplan" des Bürgerbündnisses überzeugten schließlich auch den Gemeinderat: Die Beschlussvorlage für den Antrag wurde am 21. Oktober einstimmig angenommen. Für Zeiner ist das "unglaublich". Natürlich, könnten die Bürger jetzt sagen, liegt die Verantwortung nach dem Beschluss ganz bei der Stadt. Aber die Initiative wolle weiterhin sichtbar sein, verspricht Zeiner. "Wir wollen zeigen, dass die Bürger dieses schwere Päckle bis zum Ende mittragen wollen." Institutionalisiert wird das Engagement in einem neuen Ausschuss, der aus Mitgliedern des Gemeinderats und aus Bürgerinnen und Bürgern bestehen soll. Also weiterhin Veranstaltungen, Austausch mit Experten, enger Kontakt zur Politik und Wirtschaft. Das nächste Ziel: In den kommenden anderthalb Jahren sollen die konkreten Maßnahmen, also der offizielle "Klimastadtplan" ausgearbeitet und beschlossen sein.
"Waiblingen klimaneutral" ist mittlerweile Teil der deutschlandweiten Initiative "German Zero". Immer mehr Gemeinden schließen sich dem Bündnis an, fordern das Klimaziel bis 2035 und erarbeiten Lösungen. Mehr als 50 solcher Klimaentscheide wurden laut "German Zero" seit 2020 gestartet. Allein im Rems-Murr-Kreis, der Region um Waiblingen, gibt es mittlerweile fünf Bündnisse. "Wenn immer mehr Kommunen das umsetzen, gibt es einen Dominoeffekt", hofft Zeiner. Sie steht auf der Abbiegespur, kurz vor ihrem Haus. "Dann kann es unsere Generation vielleicht noch richten", sagt sie und fügt in Schwäbisch hinzu: "Schließlich haben wir's in den besten Jahren versaubeutelt."
Wir erleben eine Zeit des Wandels. Wie steht es um die Zukunft des Landes? Welche innovativen Ideen gibt es? Das ist das Thema der großen SZ-Schwerpunkts "Zukunft Deutschland". Alle Beiträge sowie weitere Analysen und Reportagen finden Sie auf dieser Seite.